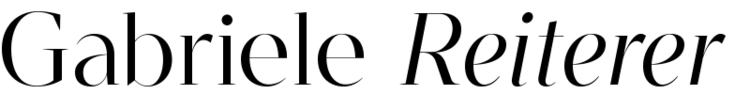Dieses Bangen am Telefon
Gabriele Reiterer
Die Presse / Spectrum
21. März 2020
Meine Eltern, 93 und fast 94 Jahre alt, sind gefasst angesichts der Bedrohung durch das Coronavirus. Ich bin es nicht. Meine Familie lebt in Südtirol, ich lebe in Wien. Und wo ist eigentlich mein Daheim? Vom Leben zwischen den Welten in Zeiten der Krise.
Meine Schwägerin knallt den Teig hart auf die carta da forno.
Durch das Telefon klingt das Geräusch wie eine Explosion. Meine Schwägerin lebt, so wie mein älterer Bruder und meine 18-jährige Nichte, in Meran, Südtirol. Und meine Eltern, die 93 und knapp 94 Jahre alt sind. Sie beide erweisen sich in den vergangenen Wochen als beeindruckend gefasst. Vielleicht weil sie in ihrem langen Leben schon viel erfahren haben und auch, dass alles irgendwann vorüberging. Das ist eine natürliche Art von Resilienz.
Ich bin derzeit nicht gefasst. Meine Familie lebt in Italien, ich lebe in Wien. So auch mein zweiter Bruder, der vor Kurzem zu unserer Erleichterung aus dem Ausland sicher hierher zurückgekommen ist. Seit der Verschärfung der Maßnahmen in Italien telefoniere ich laufend mit meiner Familie und mit dort lebenden Freunden. Aus diesem Grund überraschten mich die Maßnahmen in Österreich nicht, ich war darauf vorbereitet. Neulich träumte ich nachts von Menschen in Schutzanzügen, und als ich morgens erwachte, fiel mir The Cassandra Crossing ein, ein Katastrophenfilm mit Sophia Loren und Burt Lancaster aus den 1970er-Jahren.
Gleich morgens nach dem Fruühstuück beginnt für mich seit Tagen der Liveticker Südtirol. Meine Freundin erzählt mir, dass sie gestern in Algund einen Espresso getrunken hat, also verbotenerweise die Gemeinde Meran verlassen hatte. Dafür droht, wenn man erwischt wird, ein empfindlich teures Strafmandat. Ihre Stimme klingt so wie stets in diesen Tagen, ärgerlich und ironisch zugleich. Ihren Schilderungen entnehme ich die Folgen einer andauernden Art von Hausarrest. Keine Fahrten im Auto. Einkaufen im Supermarkt findet unter Kontrolle statt: Bis zu 20 Personen werden eingelassen, und über Lautsprecher tönt alle paar Minuten die Anweisung, zweisprachig natürlich, Abstand zu anderen Personen zu halten. Hustende Menschen werden denunziert, berichtet sie und meint, dieser Verhalt erinnere sie an die Geschichten, die aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählt werden, als man sich des anderen nicht mehr sicher sein konnte.
„Werden wir jetzt das neue Italien?“, titelte vor einer Woche in Wien eines der Gratisblätter, das auf dem Boden des D-Wagens lag. Ich beugte mich darüber und las zwischen Dreck und Fußabdrücken den reißerischen Beitrag über „beinharte Anti-Virus-Regeln“ und dass jetzt alle Österreicher heimgebracht würden. Für einen Moment fühlte ich mich eigenartig und fragte mich: Wo bin ich denn daheim? Geboren und aufgewachsen in Südtirol, die Heimat mit 18 Jahren verlassen habend, seitdem lebe und arbeite ich mit Umwegen in Wien. Merkwürdige Gefühle überkamen mich, denn ich wusste, wenn ich jetzt heimfahre, dann komme ich aus dem Daheim nicht mehr heraus. Was und wo daheim ist, ist überhaupt und vor allem in einer solchen Situation schwer zu beantworten. Muss ich mich entscheiden, wo ich hingehöre? Solche Fragen habe ich mir lang nicht mehr gestellt. Aber meine Eltern leben in dem Daheim, und plötzlich überfällt mich der Gedanke: Was ist, wenn meine Eltern sterben, und das ist bei über 90-Jährigen nicht unwahrscheinlich. Dann kann ich nicht zur Beerdigung reisen. Das heißt, ich kann vielleicht schon, aber mit Folgen. Und die Beerdigung wird ein Corona-Begräbnis mit minimierter Teilnehmerzahl und ohne Körperkontakt der Trauernden untereinander. So lauten die Verordnungen.
Das Wording der Gefahr
Später telefoniere ich mit meinem Bruder. Aus seinen Worten spüre ich die Gemengelage von Unberechenbarkeit und Furcht. Nicht zu wissen, was ist und was als Nächstes kommt, ist bedrohlich. Er schickt ein Bild der Titelseite der deutschsprachigen Tageszeitung „Dolomiten“, auf der in riesigen schwarz-roten Lettern prangt: „Ganz Italien samt Südtirol Sperrzone“. Sperrzone, rote Zone, das Wording vermittelt größte Gefahr. Isolation erzeugt eine Urangst, und sie kann eine Foltermethode sein. Sie bedeutet, dem Menschen den ursprünglichsten Schutz durch die Gemeinschaft zu nehmen. Mein Bruder ist wie viele auf mehreren Ebenen betroffen, als Unternehmer, als Vater und als Sohn. Auch er schwankt zwischen Furcht und Ärger über die Einschränkungen. Von seltsamen Szenarien wird berichtet: Busfahrer, die hinter einem Glasschutz sitzen, die Fahrzeuge werden laufend desinfiziert, Personenkontrollen durch Carabinieri und andere Exekutivorgane, die bei keinem nachweislich wichtigen Grund für die Fortbewegung eine Ordnungsstrafe einheben. In den Lokalen wurden die Besucher laufend hingewiesen, einen Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten. „Ich fühlte mich beim gemeinsamen Espresso in der Bar, als würde ich mein Gegenüber im Strafvollzug besuchen“, ätzte meine Schwägerin. Jetzt sind sie überhaupt geschlossen, die Lokale. Es wird geraten, auch niemanden zu sich einzuladen. Wie lange können Menschen so einen Zustand ertragen, frage ich mich. Wie lange ist er zumutbar? Wochen, Monate? Wie weit darf ein Staat mit solchen Maßnahmen gehen?
In der jüngsten Vergangenheit hat sich auch hier die Situation schlagartig geändert. Ende vergangener Woche bekam ich in meinem Supermarkt in der Himmelstraße einen Vorgeschmack. Hinter mir an der Kasse ein randvoller Einkaufswagen, deren Benutzerin mich anfuhr: „Vordrängeln und keinen Sicherheitsabstand halten. Typisch Grinzing.“ Ich starrte auf meine einsame Dose Tomaten und den grünen Salat, und für einen Moment war ich versucht, ein „Falsch – Italienerin!“ zurückzuschleudern, unterließ es aber, denn damit brächte ich mich derzeit vermutlich in Gefahr. Überhaupt spüre ich seit Tagen ein flaues Gefühl diffuser Angst. Das beste Mittel gegen Angst ist immer noch sachdienliche Information. Wolfgang Liebert, Risiko- und Technikfolgenwissenschaftler an der Boku und lieber Freund – die Ereignisse fallen in seine Kompetenz –, erklärt mir am nächsten Tag die Lage aus Sicht des Forschers. Er beruhigt mich, lässt zugleich aber durchblicken, dass die momentane Situation ein Vorgeschmack auf einen wahren „Ernstfall“ sein könnte, der freilich noch nicht eingetreten ist.
Was er erzählt, weiß ich zum Teil bereits selbst. Keiner kann derzeit genau sagen, welcher Typ Virus mit SARS-CoV-2 zirkuliert. Was wir sicher von ihm wissen, ist seine unglaubliche Virulenz, und daher wird versucht, durch – berechtigte – Maßnahmen zu verhindern, dass die Ansteckungswelle exponentiell durch die Decke schießt. Wir wissen nicht, ob wir zukünftig mit diesen Viren werden leben können, ähnlich wie mit Influenza, ob dieses Virus sich an „nur“ saisonale Wirksamkeit halten wird oder nicht. Zum Glück ist es für die meisten nicht hoch pathogen, denn in Verbindung mit der Virulenz wäre dies wirklich schlimm. Die Forschung kann mit den ihr zur Verfügung stehenden Methoden nur versuchen, schnell geeignete Medikamente zu entwickeln, um Schwerkranke zu retten. Hoffentlich kann dann auch ein Impfstoff folgen.
Nach dem Gespräch erklärt sich für mich besser, was in Italien und nun in Österreich geschieht. Die Konsequenzen sind nicht leicht zu tragen, die Maßnahmen müssen aber sein. Sonst ist absehbar, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht.
Meine Mutter möchte jetzt doch einen kleinen Lebensmittelvorrat. Sie ordert bei meiner Schwägerin Erdäpfel und Eier, von denen sie größere Mengen im Haus haben will. Am Telefon, das in Dauerbenutzung ist, klingt ihre Stimme nun leiser als sonst. „Kein Auto fährt am Haus vorbei, gespenstisch“, berichtet sie, und dann wird ihr Tonfall noch eine Spur schwächer: „Du darfst jetzt nicht kommen. Es ist zu gefährlich, und dann lassen sie dich nicht mehr aus dem Land.“ – „Zu Ostern werde ich kommen“, erwidere ich. Ostern ist trotz gegenteiliger Ahnung meine Hoffnung, und ich bemerke, wie mein geliebter Vater, den ich jetzt am Telefon habe, immer wieder hörbar zwischen den Worten schluckt. „Ja, wenn es zu Ostern dann besser ist, kommst du“, sagt er, und ich spüre sein Bangen, und es zerreißt mir fast das Herz in diesem Moment. Was mag in ihm vorgehen? Welche Gefühle löst die derzeitige Lage bei einem Menschen aus, der einst Kriegszeiten erlebt hat?
Die Dramaturgie des Filmes The Cassandra Crossing ist einfach und wirkt. Ein schwedischer Terrorist infiziert sich bei einem Anschlag auf ein Labor der fiktiven internationalen Gesundheitsorganisation in Genf mit einem tödlich mutierten Pestbakterium. Er flüchtet in einen europäischen Transkontinentalzug, der, voll besetzt mit Infizierten, auf höchste Weisung in ein Quarantänelager nach Polen umgeleitet werden soll. Dazu muss er die Kassandrabrücke passieren, eine baufällige Eisenbrücke, die das kalkulierte Potenzial birgt, unter der Last des Zuges einzustürzen. Damit wären alle Probleme gelöst, die Infektionsträger würden in einem Abgrund einer menschenleeren Gegend zugrunde gehen. Der mittelmäßige Film transportiert vor allem eines, nämlich eine Aura der Angst und ihre Zutaten: ein pathogener Krankheitskeim und ein aus dem Ruder laufendes Szenario mit drohend letalen Folgen.
Verlust des Filters Vernunft
Mit der diffusen Angst ist derzeit vielleicht am schwersten umzugehen. Angst ist sprichwörtlich ein schlechter Ratgeber. Mitverantwortlich dafür ist auch die Frontalität der (sozialen) Medien und dadurch oftmals der Verlust des Filters Vernunft. Was bereits zum jetzigen Zeitpunkt helfen kann, ist die essenzielle Frage, was wir aus der Situation lernen. Wenn wir das Virus überstanden haben, und das werden wir, spätestens dann sollten wir uns Gedanken machen, unter welchen Bedingungen alles entstanden ist. Der naive Glaube, dass wir in stabilen Verhältnissen leben, und unser Beharren auf illusionären Sicherheitsvorstellungen müssen infrage gestellt werden, so der Risikoforscher. Wenn sich die Situation wieder stabilisiert hat, müssen wir etwas verändern, um zukünftig Gefahren zu reduzieren. Selbst wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig über die Umstände der Entstehung wissen, sind Coronavirus und dessen Folgen auch ein Symptom einer hochgezüchteten, hybriden Gesellschaft und der Anfälligkeit global vernetzter Systeme.
Nicht zuletzt müssen wir unser Verhältnis zur Natur befragen. Friedrich Hölderlins Schöpfungsode an deren unendliche, aber zu umhegende und niemals zu vernutzende Lebenskraft ist in meinen Gedanken. Und als ob die Natur zu mir sprechen wollte, ist über Nacht die Magnolie in meinem Garten aufgeblüht. Ihr morgendlicher Anblick rührt mich zu Tränen.
So betrachtet, ist eine Pandemie auch eine Art Lackmustest für die innere Befindlichkeit unserer Gesellschaft. Wie sozial sind wir aufgestellt, und wie wichtig sind uns die anderen? Können wir geeint mit einer Problemsituation verfahren? Uns gegenseitig helfen? Halten wir Störungen unseres Wohlstandslebens noch aus, oder bringen uns Irritationen unserer Komfortzone ins Schleudern? Es ist uns selbstverständlich geworden, fraglichen materiellen Wertsetzungen anzuhängen. Und bedenkenlos Ressourcen zu verschwenden. Nun sind wir aufgefordert, grundlegend umzudenken. Noch nicht absehbare Folge nach Corona werden Neuordnungen sein, wie immer diese aussehen werden. Bereits jetzt zeigen die Menschen auch eine Welle von Zuversicht und Solidarität. Wir werden, und es ist nur eine Frage der Zeit und unserer Fähigkeit zur Resilienz, dieses Virus überstehen. Aber anschließend ist es höchste Zeit, unsere Zukunft zu reparieren.